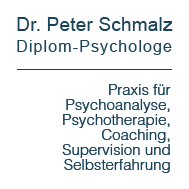Analytische Psychotherapie/Psychoanalyse
Ebenso wie bei allen alltäglich erscheinenden psychischen Vorgängen (z. B. dem Vergessen, Verlegen oder der sprichwörtlich gewordenen Freud´schen Fehlleistung/“Versprecher“) sind bei psychischen Erkrankungen unbewusste Prozesse maßgeblich.
Jeder Mensch entwickelt seine ureigenste, unverwechselbare Persönlichkeit auf der Grundlage biologischer Reifungsschritte und sozialer Erfahrungen (zuvorderst in der Familie) im Rahmen von bestimmten, in der Gesellschaft geltenden Regeln (Kultur). Von Geburt an ist aber auch eine Störanfälligkeit dieser Entwicklungsschritte oder Phasen gegeben, die aus unterschiedlichen Gründen ausgeprägter oder weniger ausgeprägt sein kann. Im ungünstigen Falle kommt es dann zu Entwicklungsstörungen, die als seelische Konflikte in der Psyche wirksam werden. „Lösungen“ dieser Konflikte können sich im späteren Leben als psychische Erkrankungen bemerkbar machen. Ängste, depressive Erkrankungen oder auch Zwangserkrankungen (um nur einige zu nennen) zeigen dann an, dass es Störungen gegeben haben könnte. Bei anhaltenden Beschwerden besteht die Möglichkeit, dass die betreffende Person einem inneren Konflikt verhaftet geblieben ist, den sie selbst nicht angemessen lösen konnte oder kann, weil sein Inhalt heute dem bewussten Zugang versperrt erscheint.
Die Ursachen solcher Konflikte sind im Einzelfall ausgesprochen individuell ausgestaltet, kreisen inhaltlich jedoch häufig um Themenkreise wie einen Mangel an Aufmerksamkeit für grundlegende Bedürfnisse, fehlende oder zu wenig Anerkennung, hohe Leistungsansprüche oder auch Unsicherheit in Beziehungen.
Psychoanalyse oder Analytische Psychotherapie kann Zugänge und neue Lösungsmöglichkeiten für solche Konflikte und Erkrankungen aufzeigen. Sie bedient sich dabei bestimmter Techniken und eines spezifischen Settings. Die Behandlung findet in zwei bis drei Sitzungen pro Woche statt, wobei der Patient i. d. R. auf einer Couch liegt und seinen Gedanken, Gefühlen und Einfällen freien Lauf lässt. Aufgabe des Analytikers ist es, dabei auf alles zu achten, was geschieht, zurückhaltend mit allen Sinnen aufmerksam zu sein, zuzuhören, abzuwarten, welche Zusammenhänge auftauchen, die dem Patienten bisher vielleicht entgangen sind, und ihm diese interpretierend oder deutend zur Verfügung zu stellen.
Im Laufe der Zeit schälen sich oft bestimmte Themen heraus, deren überragende Bedeutung für den Patienten sich in vielfältigen Formen immer deutlicher zeigen kann. Diese gilt es durchzuarbeiten, d. h. von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten, um sie möglichst in ihrer umfassenden unbewussten Dimension erfassen zu können. Dabei ist es oft überraschend, wie sich diese zentralen Themen auch innerhalb der psychotherapeutischen Beziehung zwischen Patient und Analytiker/Psychotherapeut als Wiederholungsmuster zeigen. Geschieht dies, kann es dann ein Entwicklungspotential enthalten, wenn man gewissermaßen vor Ort die Möglichkeit hat, zu untersuchen, was beide dazu beigetragen haben, welche Phantasien, Hoffnungen, Wünsche oder auch Ängste damit verbunden sind. Dadurch können sich langsam die unbewussten Motive für die zentralen Konflikte herausarbeiten und besser verstehen lassen. Das bessere Verständnis und der bewusste Zugang zu zuvor unbewussten Konflikten ermöglicht es oftmals, neue Lösungen zu finden. Solche Einsichten können die ursprünglichen Symptome abmildern oder überflüssig machen.
Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (TP)
Verglichen mit der Analytischen Psychotherapie konzentriert sich die Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie stärker auf die aktuell bestehenden Probleme und Konflikte im Kontext der aktuellen Beziehungen. Die in der Tiefe liegenden unbewussten Ursachen und Strukturen hierfür bleiben zwar nicht unberücksichtigt, stehen jedoch weniger im Fokus der Behandlung. Während es ein Ziel der analytischen Psychotherapie ist, pathogen wirksame (krankmachende) Persönlichkeitsstrukturen zu ändern, zielt die TP eher auf Symptomreduktion und Verhaltensänderung durch Einsicht in unbewusst ablaufende kommunikative Prozesse in alltäglichen Beziehungen und Situationen. Allerdings sollten auch Strategien erarbeitet werden, die es ermöglichen können, in belastenden Alltagssituationen besser zurechtzukommen oder den Mut zu finden, sich zu ändern. Hier kann es vielleicht sinnvoll sein, an einer Stabilisierung des Selbstwertgefühls zu arbeiten, wenn z. B. starke innere Unsicherheit besteht – um nur ein Beispiel zu nennen.
Kurzzeittherapie
Als Kurzzeittherapie werden Behandlungen bezeichnet, die nicht mehr als 24 Sitzungen umfassen. Sie sind dann indiziert und sinnvoll, wenn akut krankheitswertige psychische Störungen auftreten, die dann oftmals auf schwer zu bewältigende Lebenssituationen zurückgeführt werden können. Man spricht dann auch von Krisenintervention bei umschriebener, eingrenzbarer Konfliktproblematik.
So kann es sein, dass jemand mit einer Trennung nicht zurechtkommt oder mit plötzlichen Ängsten aufgrund geänderter Lebensverhältnisse reagiert. Oftmals spricht man hier von akuten Belastungsreaktionen, in denen Menschen, die ansonsten keine auffallenden psychischen Schwierigkeiten haben, plötzlich seelisch überfordert sind.
In so einem Fall sind bis zu 24 Sitzungen häufig ausreichend, die plötzlich aufgetretenen Schwierigkeiten zu verstehen und fokussiert therapeutisch zu bearbeiten, sodass eine Stabilisierung erreicht werden kann.
In seltenen Einzelfällen reichen die Vorgespräche für die Entscheidung oder Indikation, welche Form von Psychotherapie bei den bestehenden Beschwerden angebracht ist, nicht aus. Dann wird eine Kurzzeittherapie zur erweiterten Indikationsstellung beantragt.
Kurzzeittherapien können grundsätzlich auch in eine Langzeittherapie umgewandelt werden, wenn eine begründete Indikation vorliegt.
Langzeittherapie
Als Langzeittherapien werden Behandlungen mit mehr als 24 Sitzungen bezeichnet. Bei einer Tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie handelt es sich dabei in der Regel um 60 bis 80, im gesondert zu begründenden Höchstfall auch um 100 Sitzungen à 50 Minuten. Die Analytische Psychotherapie ist grundsätzlich als Langzeittherapie zu verstehen und umfasst 160 bis 240, im Höchstfall 300 Sitzungen à 50 Minuten.
In der Regel sind Langzeittherapien dann sinnvoll, wenn die bestehende Problematik bereits länger anhält, die Lebensführung erheblich beeinträchtigt ist, kombinierte symptomatische Beschwerden auftreten und mehrere Lebensbereiche betroffen sind.